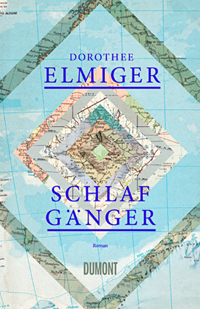Hart, aber herzlich: die Berliner Schnauze
Seit über zehn Jahren lebt die Schriftstellerin Ilma Rakusa abwechslungsweise in Zürich und Berlin. Im Mailwechsel mit Urs Heinz Aerni berichtet sie von den Unterschieden zweier Metropolen, die sich nicht zuletzt in der Sprache manifestieren.

Frau Rakusa, kürzlich ist Ihr neues Werk «Aufgerissene Blicke» erschienen, eine Art Berlin-Tagebuch. Berlin boomt, und zwar so, dass Paris schon eifersüchtig ist. Woran liegt das?
Berlin ist für mich ein Scharnier zwischen Ost und West. Ich selber stamme aus dem Osten, habe Slawistik studiert und ein Jahr in Leningrad, heute St. Petersburg, verbracht. Wenn ich im Scheunenviertel, in der Grossen Hamburger Strasse, an Fassaden Einschusslöcher entdecke und im Winter Braunkohlegeruch einatme, wenn Russisch und Polnisch an mein Ohr dringt, ist mir das seltsam vertraut. Seit über zehn Jahren habe ich eine Wohnung im alten jüdischen Viertel Berlins und fühle mich dort auf eine besondere Weise zu Hause. Keine Frage, vieles tut weh, die Vergangenheit wirft lange Schatten bis in die Gegenwart. Doch das Regenerationsvermögen der Stadt ist unglaublich. So viel Umbruch und Erneuerung wie hier ist mir sonst nirgends begegnet. Man laboriert an Widersprüchen und vollbringt zugleich kleine Wunder. Berlin steht deshalb für Experiment, Wandel – und zuletzt auch für Erschwinglichkeit. Zurzeit hört man in den Strassen auffallend viel Spanisch.
Hört man auch noch die «Berliner Schnauze»? Die einen schätzen sie, die anderen haben ihre liebe Mühe mit ihr, der berühmten Unverblümtheit der Berliner. Wie ist es mit Ihnen?
Ich kenne die ruppige Art mancher Berliner, sie ist durchaus gewöhnungsbedürftig. Andererseits hat Direktheit manchmal auch ihr Gutes. Es gibt ja auch eine spontane Offenheit, die zunächst überrascht und dann sehr erfrischend wirkt. Zum Beispiel wenn in der Bäckerei eine Verkäuferin, die mich nur wenig kennt, meinen Armreif lobt. Nie ist mir derlei in der Schweiz passiert, dafür begegnet man in Zürich eindeutig mehr Höflichkeit als in Berlin. Das kann wohltuend sein, schafft aber auch Distanz. Mitunter ist mir die spontane Berliner Art lieber.
Wie erleben Sie die beiden Städte, wenn man nicht den Dialekt oder den Kiez-Kodex beherrscht?
In Zürich ist es zweifellos von Vorteil, den Dialekt zu beherrschen, wie ich das seit langem tue, denn er transportiert nicht nur Inhalte, sondern auch Gefühle. Um das Erlernen eines Kiez-Codes in Berlin aber habe ich mich nie bemüht. Ich wüsste nicht einmal, worin er genau besteht. In jedem Kiez leben so viele unterschiedliche Menschen, dass es illusorisch wäre, eine «Zugehörigkeit» anzustreben. Auch wenn ich meinen Kiez schon lange kenne und mit etlichen Kiez-Bewohnern befreundet bin, bleibe ich doch eine Fremde. Das stört mich im übrigen keineswegs, denn die innere Verbundenheit ist da.
Sie zitieren in Ihren sehr persönlich gehaltenen Notizen den in Saarbrücken geborenen Künstler Max Neumann: «Berlin ist eine Lebensart, nicht eine Stadt.» Wie äussert sich diese Lebensart?
Um ehrlich zu sein: Ich kenne kaum waschechte Berliner. Fast alle meine Freunde sind zugezogen, leben seit zehn, zwanzig oder dreissig Jahren in Berlin, sind geblieben, weil sie die Stadt mögen und weil sie hier problemlos aufgenommen wurden. Anders als in München oder Zürich herrscht wenig Bürgerliches, die Kommunikation zwischen den sozialen Milieus ist relativ locker, im Theater muss man eher darauf achten, dass man nicht overdressed ist. Diese Lässigkeit wirkt angenehm. Freilich bin ich im ehemaligen Osten Menschen begegnet, denen man die DDR-Sozialisierung deutlich anmerkt. Das äussert sich in einer gewissen missmutigen Verklemmtheit, auch in Misstrauen. Von Weltoffenheit ist da wenig zu spüren.
Hat Ihre Wohnstadt Zürich auch eine «Lebensart»?
Was den Zürcher ausmacht, wüsste ich schwer zu sagen. Gibt es ihn überhaupt? Auch in Zürich verkehre ich mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit schweizerischen Japanern, Kasachen, Ungarn, Serben, Israelis usw. Und: Lebt man sehr lange in einer Stadt, entwickelt man eine gewisse Blindheit gegenüber ihrer Eigenart. Zürich ist heiterer und weltoffener geworden, das fällt mir positiv auf. Das zwinglianische Erbe ist etwas in den Hintergrund getreten. Doch könnte die Atmosphäre von mir aus gerne noch lockerer werden, dann brauchte es vielleicht weniger psychologische Praxen.
Freilich ist auch in Berlin die Atmosphäre nicht uneingeschränkt locker, die historische Last der Stadt wiegt schwer – wo spüren Sie am meisten davon?
Im Grunde auf Schritt und Tritt. Kaum verlasse ich das Haus, erinnern mich auf dem Gehsteig «Stolpersteine» an die einstigen jüdischen Bewohner, die zumeist in den Gaskammern endeten. Auf dem Koppenplatz, in der Grossen Hamburger Strasse – überall finden sich Mahnmale für ermordete Juden. Und gehe ich die Ackerstrasse entlang Richtung Bernauerstrasse, erinnern mich Reste der Mauer an den Wahnsinn des geteilten Berlins. Bisher habe ich nur vom Radius meiner normalen Spaziergänge gesprochen, nicht vom Besuch der zahlreichen Museen. Kurz, ganz Berlin ist ein Mahnmal. Ob man will oder nicht, die Geschichte holt einen überall ein.
Wie geht man als Gast mit diesem Erbe um? Wie «übersetzt» man es in die eigene Sprache, den eigenen Text?
Ich weiss nicht, ob man sich auf einen Gast-Status herausreden darf. Mich erschüttert diese Geschichte, auch wenn ich nach dem Krieg und in Rimavská Sobota zur Welt gekommen bin. Und das merkt man meinem «Journal» an. Ich schreibe nicht nur oft, sondern mit einer gewissen Betroffenheit von Orten, wo Berlin seine Schrecken und Wunden herzeigt. Das hat nichts mit Sentimentalität zu tun, vielmehr mit dem Bedürfnis, mir selber Klarheit zu verschaffen. Denn der touristische Blick neigt ja eher zu Stereotypen und zur Verklärung. Kritik setzt in der Regel dann ein, wenn man länger an einem Ort ist und den Alltag kennenlernt.
Man hat manchmal den Eindruck, gerade unter Schweizer Autoren finde eine Art Exodus nach Berlin statt. Erlauben Sie mir die kritische Anmerkung, dass die Schweizer Optik auf Berlin vielleicht etwas zu wohlwollend ausfällt. Kann die literarische Liebe auch etwas blind machen? Oder: soll sie es sogar?
Auch Berlin bekommt Kritik ab, keine Sorge. Die Gentrifizierung spreche ich in meinem Buch mehrmals kritisch an. Auch die Missstände bei der S-Bahn. Das Flughafendebakel etwa kam aber später. Ich finde es eine Schande, was sich Berlin da leistet. Es gibt nichts schönzureden. – Blind bin ich gegenüber Berlins Schwächen keineswegs, auch wenn ich seine sogenannten Pro-blembezirke, wo schlecht integrierte Jugendliche aus Migrantenkreisen oder solche mit rechtsradikalen Tendenzen ihr Unwesen treiben, mehr vom Hörensagen kenne. Viele bislang in Berlin ansässige Autoren ziehen übrigens gerade weg, nach Leipzig oder aufs Land, weil sie von der hippen Hauptstadt genug haben. Dass sich einige Schweizer Schriftsteller nach Berlin orientieren, sei ihnen nicht verargt. Sie finden dort eine ungeheuer vielfältige Kulturszene vor, allein das Theaterangebot verschlägt einem den Atem. Das ist anregend. Ebenso anregend ist es, täglich mit der deutschen Sprache als Umgangssprache konfrontiert zu werden. Wo lernt man diese in der Schweiz?
Wie bricht sich für Sie die Wahrnehmung durch die Wiedererzählung? Andere photographieren, Sie schreiben; wo liegt für Sie der Vorteil des sprachlichen «Wiederkäuens»?
Das Wort steht nicht in Konkurrenz zum Bild, es ist ein eigenes Medium mit eigenen Möglichkeiten. Und es steht auch nicht in Konkurrenz zum cinéma vérité. Von «Vorteil» möchte ich daher nicht reden. Persönlich allerdings drängt es mich, Erlebtes zu verschriftlichen, durch die «Wiedererzählung» eine subjektive Sichtweise und eine spezifische Intensität zum Ausdruck zu bringen. Das ist mein Beruf oder, wenn man so will, meine déformation professionelle. Schreibend erfahre ich vieles neu, unter der Hand verwandeln sich Wahrnehmungen und Erlebnisse, gehen unerwartete Zusammenhänge ein. In meinem Wesen bin ich ein Mensch des Wortes, arbeite mich ständig daran ab, den Transfer vom Geschauten zum Geschriebenen zu leisten. Zu den geduldigen «Übersetzern» oder Erzählern gehöre ich freilich nicht. Vom Temperament her Lyrikerin, mag ich die knappe, suggestive Evokation von Eindrücken und Erlebnissen.
In welche nächste Stadt würden Sie gerne fürs nächste «Journal» geschickt werden?
Ich möchte mir diese Stadt selber aussuchen. Zum Beispiel St. Petersburg oder Sarajevo.