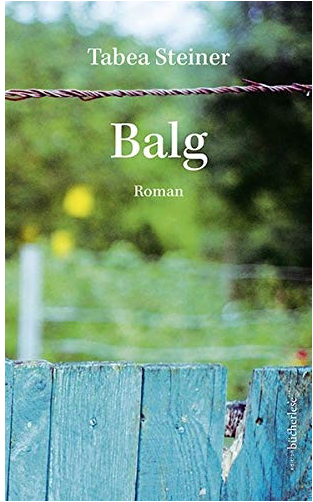«Der Text muss
durch dich hindurch»
Sich zurücknehmen, ohne zu verschwinden: Yla Margrit von Dach, die «Grande Dame» des literarischen Übersetzens in der Schweiz, berichtet von paradoxen Aspekten ihrer Arbeit und von Unterschieden zwischen der Literatur Frankreichs und der Romandie.
Frau von Dach, welche Fähigkeiten benötigt man, um Belletristik zu übersetzen?
Das literarische Übersetzen weist zwei gegensätzliche oder mindestens komplementäre Aspekte auf. Der eine sind Sprachkenntnisse und das Wissen um kulturelle Gegebenheiten, der andere ist die Intuition.
Konkreter?
Es gibt immer eine Wahrnehmung des Textes unter der Oberfläche von Sinn, Grammatik oder formaler Struktur. Und diese unterbewusste Wahrnehmung vertieft sich während der Arbeit: Während ich übersetze, lese ich einen Abschnitt unzählige Male. Bei der ersten Lektüre sehe ich mir an, was überhaupt dasteht und was der Sinn dieser Sätze ist. Dann gehe ich bei jedem Durchgang ein bisschen tiefer und es prägt sich mir etwas ein, das auf einer Ebene Resonanz findet, die nicht mehr ganz so verstandesbetont ist. Manchmal denke ich, dass das Gelesene in eine Art Sprachlosigkeit der Wahrnehmung absinkt, die nachher, wenn es sozusagen wieder an die Oberfläche zurückkehrt, das Verständnis beeinflusst.
Sie leben abwechselnd in Biel und Paris, übersetzen Texte aus der Romandie und Frankreich. Gibt es bedeutende Unterschiede zwischen beiden Literaturen?
Ja, durchaus. Ich erinnere mich gut daran, wie es war, als ich das erste Mal in Frankreich war: Wenn man von einem Buch sprach, dann immer von einem Roman und seinen personnages, seinen Figuren. Der Autor sagte dann, die Figur habe gemacht, was sie wollte, und er habe ihr mit seinem Schreiben nur folgen müssen. Man hat die Literatur also sofort auf eine psychologische Ebene versetzt, auf der sich die Leser mit den Figuren identifizieren konnten. In der Literatur, die ich aus der Westschweiz übersetzt habe, beispielsweise François Debluë oder auch Catherine Colomb, tritt das Psychologische oft in den Hintergrund gegenüber einem Umgang mit Sprache, der formale Elemente aufnimmt, und vor einer Bildhaftigkeit, die eben nicht mehr unbedingt psychologisch zu deuten ist. Schweizer Autoren betonen die formale Seite stärker. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass hier solche Literatur überhaupt rezipiert wird.
Wie verhält sich nun das Deutsche dazu?
Die deutschsprachige Literatur hat eine andere Herangehensweise an die Wirklichkeit. Das Deutsche hat etwas sehr konkret Bildhaftes: Wir sagen Birnbaum, und man sieht die Birne und den Baum. Die Franzosen sagen poirier, cerisier, cendrier oder marronier. Das Suffix ist schon kein Bild mehr. In dieser Hinsicht, und ich würde meinen, ganz allgemein, ist das Französische anders in der konkreten Realität verankert als das Deutsche.
Welche Auswirkungen hat das?
Es beeinflusst, wie man metaphorische Elemente verwendet und empfindet. Die Eloquenz des schönen Klanges wird in der Suisse romande immer noch sehr geschätzt und das lateinische Sprachgefühl goutiert gerne ein gewisses Pathos. Für deutschsprachige Leser muss die Emphase oft ein bisschen zurückgedimmt werden, sonst verrät man den Text. Als Übersetzerin muss ich immer auch bedenken, wie er aufgenommen wird.
Sie schreiben seit langer Zeit auch selbst. Wo liegen die grössten Unterschiede zum Übersetzen, wo die Gemeinsamkeiten?
Da komme ich wieder auf die unterbewusste Seite zurück, von der ich anfangs gesprochen habe. Wenn man einen Text schreibt, hat man zu Beginn das undefinierte Gefühl, etwas zum Ausdruck bringen zu wollen, und plötzlich sieht man: das ist es. Wenn ich selber schreibe, mache ich das nicht wie in einem Essay, wo man ganz rationalen Schritten folgend Inhalte in einer bestimmten Form zusammenstellt, um zu einem Schluss zu gelangen. Es ist etwas viel Unfassbareres. Hier gelangt das Übersetzen durchaus in die Nähe des Schreibens, obwohl man sich auf einen vorhandenen Ausgangstext bezieht. Man bekommt ein beinahe sprachloses, unfassbares Gefühl für den Text – von seinem Rhythmus, seiner Musikalität und Bildhaftigkeit und von allem, was aus diesen einzelnen Elementen an Resonanzen entsteht. Jedes Bild hat eine Resonanz innerhalb des Gesamttextes, jeder Klang eines Wortes. Wer einen fremden Text übersetzt, muss diese Resonanzen möglichst breit, möglichst offen sich entfalten lassen.
Läuft man dann nicht auch Gefahr, Dinge in den Text zu interpretieren, die nicht darin angelegt sind?
Je besser die Übersetzung, desto unsichtbarer der Übersetzer. Letzterer sollte also nicht aus seiner eigenen Befindlichkeit oder Erfahrungsvoraussetzung urteilen. Man kann einen Text damit völlig zerstören oder verfälschen. Das ist gerade bei älteren Übersetzungen oft passiert: ich erinnere mich an erste Übersetzungen von Robert Walser ins Französische, die so geschniegelt daherkamen, dass von Walsers Widerständigkeit wenig übriggeblieben war. Viel zu reden gab in Frankreich auch die Neuübersetzung der Romane Dostojewskis, dem man übersetzenderweise lange die französische Eleganz und bienséance aufgezwungen hatte.
Sie meinen: für diese Arbeit braucht es ein gewisses Mass an Selbstaufgabe?
Wer übersetzt, muss akzeptieren, dass der Autor seine Weltsicht auf seine ganz eigene Art zum Ausdruck bringt. Bei gewissen Schriftstellern, die auch übersetzen, hatte ich das Gefühl: das Ergebnis ist zwar sehr interessant, aber man sieht doch vor allem den Fingerabdruck des Schriftstellers. Andererseits muss ein Text in der letzten Phase der Übersetzung eine Kohärenz erhalten, die er nur durch die Person des Übersetzers erhalten kann.
Und wenn es sich um mehrere Personen handelt, die an der Übersetzung eines Textes arbeiten?
An einem Übersetzungsseminar haben wir einmal das Experiment gewagt, ein Stück Text demokratisch zu übersetzen. Wir waren ungefähr ein Dutzend Teilnehmer und hatten jeweils vier bis fünf Versionen eines Satzes vorliegen; dann wurde darüber abgestimmt, welche Version die beste war. Jeder einzelne Teilnehmer hatte ausserdem noch eine eigene Übersetzung des Textes erarbeitet. Am Ende stellten wir fest, dass der Version, die demokratisch zusammengestückelt worden war, etwas abging. Ihr fehlte einfach etwas. Das ist wieder so etwas Paradoxes, das beim Übersetzen stattfindet: einerseits muss man sich zurücknehmen, um möglichst viel von dem aufzunehmen, was der Autor sagt, andererseits kann man nicht verschwinden. Der Text muss durch dich hindurch. Das eigene Sprachgefühl, der eigene interne Rhythmus drücken sich in ihm aus.
Schreiben literarische Übersetzer und Übersetzerinnen immer auch selbst, und sei es heimlich?
Von den anderen Übersetzerinnen, die ich kenne, schreibt nicht jede. Bei mir ist es so, dass mein Werdegang davon bestimmt wurde, dass ich zuerst selber geschrieben habe. Die sprachliche Sensibilität entwickelte sich bei mir durch das Schreiben, andere haben ein Studium absolviert und sind durch die Textanalyse dazu gekommen zu übersetzen. Es ist sicher beides möglich.
Hätten Sie, wenn Sie zurückblicken, lieber «nur» geschrieben?
Nein. Wäre der Drang zu schreiben übermächtig gewesen, hätte ich es sicher getan. Warum war er es nicht? Ich habe mich nie als jemanden erlebt, der Geschichten erzählen wollte. Kaum bin ich im «Schreibmodus», tritt bei mir etwas anderes in den Vordergrund, es beginnt eine Art Ausleuchten meiner Innenwelten, und meine Szenarien und Figuren muten darin sehr traumhaft an. Dazu kam, dass nach der ersten Übersetzung sofort die zweite kam und dass sich das Übersetzen wie von selbst als eine Art Berufung herausstellte. Eine Ausleuchterin bin ich so oder so, ob ich mir dabei meine eigenen oder die Innenwelten literarischer Texte vornehme.
Yla M. von Dach
hat u.a. Nicolas Bouvier, Sylviane Chatelain und Michel Layaz ins Deutsche übertragen. Bei den Schweizer Literaturpreisen 2018 wurde sie mit dem Spezialpreis Übersetzung geehrt. Im Herbst erscheint ihr neues Buch «Kaleidoskop und Konterfei» (Verlag die brotsuppe).
Laura Clavadetscher
ist Redaktorin dieser Zeitschrift.